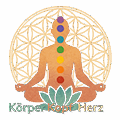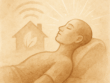Komfort und Faszination Smart Home
Smart Homes sind längst kein Zukunftsthema mehr.
Wer einmal erlebt hat, wie sich alle Rollläden mit einem Fingertipp oder per Sprachbefehl gleichzeitig öffnen, die Raumtemperatur automatisch angepasst wird oder das Licht beim Betreten eines Raumes sanft angeht, weiß: Das ist purer Komfort.
Weitere Vorteile:
- Zentrale Steuerung: Beleuchtung, Heizung, Sicherheit, Multimedia – alles über eine App oder ein zentrales Bedienpanel.
- Automatisierung: Szenen für „Feierabend“, „Urlaub“ oder „Guten Morgen“ lassen sich vordefinieren und wieder abrufen.
- Energieeffizienz: Intelligente Heizungssteuerung, automatische Lichtabschaltung und optimierte Verschattung sparen Energie.
- Sicherheit: Präsenzsimulation, Alarmmeldungen und smarte Tür-/Fenstersensoren erhöhen den Einbruchschutz.
- Flexibilität: Anpassbar an Lebenssituationen, jederzeit erweiterbar.
Kurz: Smart Home kann das Leben leichter, effizienter und angenehmer machen.
Der „Beigeschmack“: Funktechnik und Elektrosmog
Viele Smart-Home-Systeme setzen heute auf drahtlose Kommunikation – vor allem WLAN, Zigbee, Thread oder Bluetooth. Das spart Kabel, macht die Installation einfach, hat aber aus baubiologischer Sicht einen Haken:
Diese Systeme erzeugen dauerhaft hochfrequente elektromagnetische Felder (HF-EMF), die nicht nur bei aktiver Nutzung, sondern ständig senden – oft 24/7, auch im Schlafzimmer.
Was funkt im Smart Home – und wo?
- WLAN (Wi-Fi): 2,4 GHz und 5/6 GHz, sendet auch im „Leerlauf“ permanent Beacon-Signale.
- Zigbee / Matter-over-Thread: Funknetz für smarte Geräte, meist 2,4 GHz, Mesh-Technik – viele kleine Sender, die sich gegenseitig Signale weiterleiten.
- Bluetooth/BLE: Ebenfalls 2,4 GHz, häufige Werbesignale („Advertising“) auch im Ruhezustand.
Konsequenz: Je mehr Geräte, desto mehr Funkverkehr – und desto höher die Dauerexposition, auch nachts im Schlafbereich.
Was sagen Wissenschaft und Baubiologie?
- WHO / ICNIRP: Bei Einhaltung der Grenzwerte sind keine gesicherten gesundheitlichen Schäden belegt.
- IARC: Stufte HF-EMF 2011 als möglicherweise krebserregend ein (Gruppe 2B).
- Baubiologie: Kritisiert, dass die Grenzwerte nur thermische Effekte berücksichtigen – also reine Gewebeerwärmung – und nicht-thermische Effekte (z. B. Schlafstörungen, hormonelle Veränderungen) ignorieren.
- Langzeit- und Nachtaspekte fehlen: Die offiziellen Grenzwerte berücksichtigen keine erhöhte Sensibilität im Schlaf und keine Dauerbelastung.
Warum aus baubiologischer Sicht die offiziellen Grenzwerte zu hoch sind
Die ICNIRP-Grenzwerte orientieren sich fast ausschließlich an thermischen Effekten – also daran, dass sich Gewebe nicht messbar über 1 °C erwärmt.
Baubiologen kritisieren daran:
- Nicht-thermische Effekte fehlen
Forschung zeigt Hinweise auf Effekte unterhalb der Erwärmungsschwelle (z. B. oxidativer Stress, Neurotransmitterveränderung, Schlafstörungen). Diese werden in Grenzwerten nicht berücksichtigt. - Keine Langzeit- und Nachtwerte
Grenzwerte gelten für Kurzzeitexposition, ignorieren Dauerbelastung und die erhöhte Sensibilität des Körpers im Schlaf. - Deutlich niedrigere Vorsorgewerte
Beispiel:- ICNIRP: bis 61 V/m bei 2,4 GHz
- Baubiologie (SBM-2015): ab 0,06 V/m im Schlafbereich bereits „stark auffällig“
→ Faktor ~1.000.000 Unterschied
- Summationseffekte nicht beachtet
In realen Wohnungen wirken oft mehrere Funkquellen gleichzeitig – WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, Zigbee. Grenzwerte betrachten jede Quelle isoliert.
Risiken bei Dauerexposition
- Schlafqualität: Dauerstrahlung kann laut Vorsorgeansatz den Parasympathikus (Erholungssystem) stören.
- Immunsystem: Ständige Reizsignale könnten die nächtliche Regeneration beeinträchtigen.
- Kumulierte Belastung: Mehrere Funkquellen summieren sich – Router, Smart-Home-Geräte, Mobilfunk.
Die Lösung: Smart Home mit Kabel
Kabelgebundene Systeme bieten alle Vorteile des Smart Homes, aber ohne den Funk-Dauerbetrieb.
Vorteile kabelgebundener Systeme
- Gesundheit: HF-Exposition nahe null, besonders im Schlafbereich.
- Zuverlässigkeit: Keine Funkabbrüche oder Interferenzen.
- Sicherheit: Keine Funkangriffsfläche, physische Netztrennung möglich.
- Skalierbarkeit: Einfach erweiterbar, klare Struktur.
Empfehlungen für die Umsetzung
Neubau / Sanierung
- Strukturierte LAN-Verkabelung (Cat-6A/7) in alle Räume, mehrfach Dosen setzen.
- Bus-Systeme: KNX, Loxone, Modbus oder DALI für Licht und Automatisierung.
- PoE (Power over Ethernet) nutzen, um Geräte direkt über das Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen.
- HF-Zonenplanung: Falls WLAN nötig, Access Points außerhalb der Schlafräume platzieren und zeitgesteuert deaktivieren.
Bestandsbau
- Sofortmaßnahmen: Router vom Schlafzimmer weg, WLAN nachts abschalten (Zeitschaltuhr).
- LAN-Nachrüstung: Kabel über Sockelleisten oder Türzargen verlegen, Adapter nutzen.
- Funkfreie Zonen: Schlafräume und Kinderzimmer möglichst komplett funkfrei halten.
Wenn Funk unvermeidbar ist
- Low-Duty-Cycle-Geräte einsetzen, die nur bei Bedarf senden.
- Mesh-Netze reduzieren, um die Zahl der Dauer-Sender zu senken.
- Funkkomponenten bündeln, möglichst wenige Standards gleichzeitig nutzen.
Fazit
Smart Home ist komfortabel, effizient und sicher – wenn es baubiologisch sinnvoll umgesetzt wird.
Kabelgebundene Systeme bieten denselben Bedienkomfort ohne Dauerstrahlung.
Wer beim Neubau oder Umbau vorsorgt, kombiniert Technikbegeisterung mit Wohngesundheit – und macht das Zuhause nicht nur smart, sondern auch regenerativ.